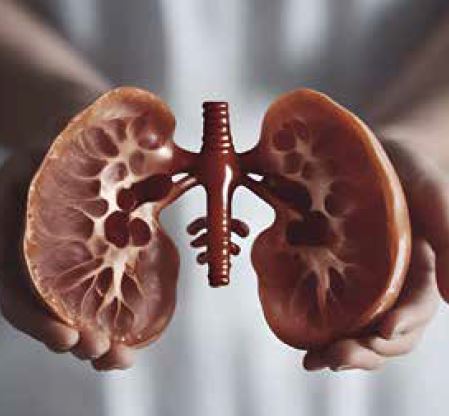|
Chronische Nierenerkrankungen führen zu einer progredienten Zerstörung der Nephrone und damit zu einem fortschreitenden Verlust der renalen Funktion. Ursachen sind neben diabetischen und vaskulären Läsionen auch Glomerulonephritis, Pyelonephritis, medikamentös bedingte Nephropathien und heriditäre Nierenerkrankungen.
Das Stadium der chronischen Funktionsabnahme definiert sich über die glomeruläre Filtrationsrate (GFR) sowie über die renale ACR (albumine-to-creatine ratio). In Teil 1 (ZMT 3/25) wurden bereits die Auswirkungen renaler Erkrankungen auf die Speicheldrüsenfunktion beschrieben. Die orale Gesundheit wird aber auch durch eine Reihe weiterer Faktoren schwer beeinträchtigt. Vermehrte Eiweißausscheidung führt zu Mikroalbuminämie, die mangelnde Erythropoetinproduktion zu renaler Anämie. Die Folge ist eine drastische Reduktion sowohl der zellulären, als auch der humoralen Immunabwehr. Candidose und alveolärer Knochenverlust bei renaler Funktionseinschränkung Schlechte Durchblutung der parodontalen Gewebe in Kombination mit einem Überhandnehmen potenziell pathogener Mikroorganismen steigert die Prävalenz aggressiver oraler Entzündungen. Nicht selten kommt es, besonders bei älteren Patienten, zu atrophischer Mukositis und damit zu schlechter Prothesenverträglichkeit. Gleichzeitig steigt das Risiko einer erythematösen oder pseudomembranösen Candidiasis. In Zusammenhang mit heriditären Erkrankungen wie Hypokalziurie oder heriditärer distaler renaler Azidose (ein Defekt in der Wasserstoffionensekretion im Tubulussystem), findet man ausgeprägte Schmelzbildungsstörungen in Form einer Amelogenesis imperfecta. Mit fortschreitender Insuffizienz der Nieren wird vermehrt Kalzium ausgeschieden und gleichzeitig Phosphat retiniert. Als Reaktion auf die daraus resultierende Hypokalziämie wird in der Nebenschilddrüse vermehrt Parathormon produziert und ausgeschüttet. Dieser sekundäre Hyperparathyroidismus induziert eine Entkalkung der Knochensubstanz. Im Röntgen findet man auch am Kiefer radiotransluzente Areale. Der Verlust an Alveolarknochensubstanz korreliert positiv mit den PTH Spiegel im Serum.
Der Nierenkranke als Risikopatient
Eine Dysfunktion der Nieren erhöht für die Betroffenen die Gefahr odontogener Infektionen und aggressiv verlaufender parodontaler Entzündungen. Die Notwendigkeit einer regelmäßigen Kontrolle und frühzeitigen Intervention bei oralen Problemen stellt eine Reihe zusätzlicher Anforderungen an den behandelnden Zahnarzt. Die aktuellen Nierenwerte des Patienten müssen regelmäßig abgefragt und im Anamnesebogen aktualisiert werden. Im Rahmen einer progredienten Niereninsuffizienz treten eine Reihe von Morbiditäten auf, die bei der Behandlung zu berücksichtigen sind. Die nicht selten mit Nierenerkrankungen einhergehende Thrombozytopenie kann bei Zahnextraktionen oder Wurzelbehandlungen zu verstärkter und verlängerter Blutung führen. Vor dentalchirurgischen Interventionen empfiehlt sich daher eine Abklärung des Haematokrits und des Gerinnungsstatus. Zwar sind chronisch Nierenkranke im Frühstadium noch relativ symptomfrei, die verminderte Ausscheidung nierengängiger Medikamente oder deren Metaboliten macht jedoch eine entsprechende Anpassung der Dosis und der Dosisintervalle notwendig. So werden etwa NSAR wie Ibuprofen, COX2 Hemmer oder Diclofenac vorwiegend über die Nieren ausgeschieden und können daher die in ihrer Funktion bereits beeinträchtigten Organe gefährden. Sie unterdrücken die Prostaglandinsynthese und haben eine blutdrucksteigernde Wirkung, welche eine renal bedingte Hypertension weiter verstärkt. Auch Acetylsalicylsäure ist wegen der Wirkung auf die Blutplättchen und damit auf die Gerinnung problematisch. Lebergängige Schmerzmittel wie Paracetamol und auch Benzodiazepine hingegen können ohne weitere Anpassung verabreicht werden. Durch die geschwächte Immunlage kommt es häufiger zu schweren bakteriellen Entzündungen des Zahnhalteapparats und der oralen Mukosa, welche eine antibiotische Begleittherapie notwendig machen. In solchen Fällen muss bei der Auswahl des Wirkstoffs auf eine mögliche Nephrotoxizität geachtet werden. Tetrazykline und Aminoglykoside sind zu vermeiden, Penicilline, Clindamycin und Cephalosporine hingegen können ohne Dosisanpassung verabreicht werden. Vorsicht ist bei der Gabe von Antimykotika bei den leider häufig rezidivierenden oralen Candidainfektionen geboten. Besonders Azole gefährden die Restfunktion der Nieren. Bei multiplen Medikationen muss der Zahnarzt, idealerweise in Absprache mit dem Hausarzt des Patienten, darauf achten, dass möglichst lange Intervalle zwischen den einzelnen Gaben liegen. Bei dialysepflichtigen Nierenkranken sollte eine Behandlung immer nur an dialysefreien Tagen durchgeführt werden. Durch die notwendige Heparinisierung ist sonst die Blutungsbereitschaft erhöht.
Infektionsgefahr nach Nierentransplantation
Durch die lebenslange immunsuppressive Therapie steigt die Gefahr der Genese und Progression von Malignomen wie dem mukosalen Plattenepithelkarzinom. Die reduzierte Immunlage begünstigt bei Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus (EBV) die Entstehung einer Haarleukoplakie, besonders an den lateralen Zungenrändern sowie seltener auch bukkal, labial und palatinal. Cyklosporin A und/oder Kortison sind zur Vermeidung einer Transplantatabstoßung erforderlich, schwächen aber die Epithelbarriere und fördern opportunistische Infektionen und Gingivahyperplasie. Schwere parodontale Entzündungen und Stomatiden sind die Folge. Zudem besteht für den gesamten Organismus erhöhte Gefahr durch bakteriämisch gestreute oralpathogene Mikroorganismen. Für nierenkranke Patienten ist in jedem Fall eine dem Stadium und Ausmaß der Grunderkrankung angepasste zahnmedizinische Betreuung erforderlich.
DDr. CHRISTA EDER
FA für Pathologie und Mikrobiologin
eder.gasometer@chello.at
|